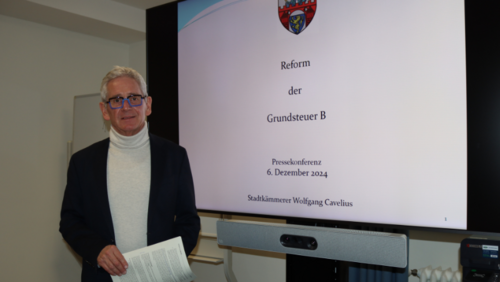Dazu Stadtkämmerer Wolfgang Cavelius: "Wir wollen eine gerechte Entscheidung im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger erreichen. Die Mehrbelastung der Wohngrundstücke ist ausnahmslos auf die Neubewertung durch das Finanzamt zurückzuführen."
Bei einem Pressegespräch im Rathaus Siegen erläuterte er heute (Freitag, 6. Dezember 2024) die umfangreiche Verwaltungsvorlage für die weitere politische Beschlussfassung und erklärte, wie sich die Hebesätze in der Praxis gestalten und welche Folgen dies für Bürgerinnen und Bürger hat. Seine Kritik: "Die Landesregierung hat das Thema Grundsteuerreform lange nicht mit der aus städtischer Sicht erforderlichen Dringlichkeit 'angepackt' und wälzt nun die Verantwortung kurz vor dem seit sechs Jahren bekannten, gerichtlich festgelegten Umsetzungszeitpunkt für eine gerechte Umsetzung auf die Kommunen ab." Nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss muss der Rat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember, die endgültige Entscheidung treffen, wie die Reform ab Januar umgesetzt werden soll.
Die Stadt Siegen strebt sogenannte "differenzierte Hebesätze" an, nach umfassender rechtlicher Abwägung von Rechtsgutachten des Landes NRW und des Städtestages NRW zur Thematik. Um die Wohnnebenkosten zu reduzieren, setzt die Stadt Siegen unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke fest. Durch die Einführung der differenzierten Hebesätze bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke soll ein teilweise starker Anstieg der Grundsteuer für Wohngrundstücke abgefedert werden.
Die konkreten Zahlen
Die Grundsteuerreform hat bislang ein zweistufiges Verfahren durchlaufen. In einem ersten Schritt wurden alle Grundstücke von der Finanzverwaltung neu bewertet und der sog. "Grundsteuerwertbescheid" erlassen. In einem zweiten Schritt wurde dieser Wert mit der sogenannten Messzahl multipliziert und daraufhin der Grundsteuermessbescheid erlassen, der sowohl den Eigentümern als auch der Kommune zugestellt werden. Bis dahin ist ausschließlich die Sphäre der Finanzverwaltung betroffen.
Erst auf der Grundlage dieses Grundsteuermessbetrages werden die Kommunen tätig, indem sie die entsprechenden Messbeträge mit ihrem jeweiligen Hebesatz multiplizieren:
Messbetrag x Hebesatz = zu zahlende Grundsteuer
Die Kommunen sind also an den Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes gebunden. Der einzige von der Gemeinde zu beeinflussende Faktor ist - wie zuvor auch - der Grundsteuerhebesatz. Wegen der unterschiedlichen Bewertungsverfahren droht bei der angestrebten "Aufkommensneutralität" ohne gesetzgeberische Eingriffe eine deutliche Lastenverschiebung zu Ungunsten der Wohngrundstücke.
Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform (also ab dem Jahr 2025) ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil hält. Aufkommensneutralität bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass die individuelle Grundsteuer jedes einzelnen Grundbesitzeigentümers gleichbleibt.
Vor diesem Hintergrund haben sich die kommunalen Spitzenverbände schon früh für eine gesetzgeberische Steuermesszahlendifferenzierung ausgesprochen und dies gegenüber der Landesregierung auch eingefordert. Das Land hat trotz aller Kritik aus den Reihen der kommunalen Familie das "Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (NWGrStHsG)" verabschiedet. Damit wird den Städten und Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, ab dem 1. Januar 2025 neben einem einheitlichen Hebesatz alternativ differenzierte Hebesätze bei der Veranlagung zur Grundsteuer B festzulegen.
Gleichzeitig hat das Land den Kommunen aufkommensneutrale Hebesätze empfohlen und zwar sowohl für einheitliche als auch für differenzierte Hebesätze. Abgesehen von Unrichtigkeiten bei den Berechnungsgrundlagen würde ein einheitlicher Hebesatz das Wohnen noch stärker belasten als bei Anwendung eines differenzierten Hebesatzes.
Da aber die Intention des Gesetzes von einer Entlastung des Wohnens geprägt ist, empfiehlt sich die Festlegung differenzierter Hebesätze. Dazu sagte Wolfgang Cavelius: "Die vom Land empfohlenen differenzierten Hebesätze widersprechen dem eigenen vom Land in Auftrag gegebenem Rechtsgutachten. Diese besagt, dass differenzierte Hebesätze nur bei einer Spreizung im Verhältnis von 1:2 rechtssicher angewandt werden können. Die empfohlenen Hebesätze von 690 zu 1.819 bedeuten aber ein Verhältnis von 1:2,6."
Ein Gutachten des Städtetages NRW hält die Anwendung differenzierter Hebesätze übrigens generell für nicht rechtssicher anwendbar. Um das rechtliche Risiko soweit wie möglich zu minimieren, hat die Verwaltung daher Hebesätze gemittelt, welche die Leitlinien der beiden Gutachten eng berücksichtigen.
Daher soll der Hebesatz für Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum) die im Ertragswertverfahren berechnet werden, ab 1. Januar 2025 auf 770 v. H. festgesetzt werden. Derjenige für Nichtwohngrundstücke (Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, sonstige bebaute Grundstücke, unbebaute Grundstücke) soll ab 1. Januar 2025 auf 1.540 v. H. festgesetzt werden.
Nicht nur aus Sicht der Stadt Siegen ist es dabei von Nachteil, dass die Grundsteuermesszahlen in Nordrhein-Westfalen - anders als etwa in Sachsen oder im Saarland - nicht einheitlich angepasst wurden, um so die Wohngrundstücke zu entlasten und einen "Flickenteppich" unterschiedlicher Regelungen im Land zu vermeiden. Die Stadt Siegen - wie andere Kommunen auch - habe nun die "undankbare Aufgabe", Wohn- und Nichtwohngebäude ausgleichend zu behandeln, um so Wohngrundstücke zu entlasten.
Dazu sagte Wolfgang Cavelius: "Ein einheitlicher Hebesatz würde zu einer spürbaren Verteuerung bei Wohngrundstücken führen. Dies ist die Folge der unterschiedlichen Wertentwicklung von Betriebs- und Geschäftsgrundstücken auf der einen Seite und Wohngrundstücken auf der anderen Seite. Dem Grundgedanken der städtischen Wohnungspolitik würde dies zuwider laufen. Aus diesem Grunde erscheint es geboten, den Gestaltungsrahmen im Zuge der kommunalen Satzungsautonomie so zu nutzen, dass Wohnen nicht über Gebühr zusätzlich belastet und aus sozial- und gesellschaftspolitischen Aspekten von der Möglichkeit zur Wahl von differenzierten Hebesätzen Gebrauch gemacht wird. Dies stellt einen Beitrag zur Stabilisierung und Eindämmung von Wohnnebenkosten dar. Bei Abwägung der in den Gutachten dargestellten Risiken mit der drohenden finanziellen Belastung für Eigentümerinnen bzw. Eigentümer oder auch Mieterinnen bzw. Mieter ist es aus sozial- und wohnungspolitischen Gesichtspunkten geboten, ab dem 1. Januar 2025 bei der Veranlagung zur Grundsteuer B differenzierte Hebesätze anzuwenden."
Cavelius abschließend: “Mit der Neuregelung hat der Landesgesetzgeber die Kommunen in eine ausgesprochen schwierige Lage gebracht. Wie soll sich eine Kommune angesichts der rechtlich unsicheren Lage verhalten? Die rechtliche Bewertung ist insbesondere bei neuen Gesetzen, für die noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung existieren, schwierig. Daher wird Gewissheit erst dann entstehen, wenn die Gerichte die Neuregelung geprüft haben. Allerdings kann dies mehrere Jahre dauern. Sachgerecht zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher, die zurzeit bestehende Rechtsunsicherheit zunächst einmal zu akzeptieren und damit umzugehen. Jedenfalls wird die Stadt Siegen - wie viele anderen Kommunen in NRW auch - im Kommunalwahljahr 2025 unverschuldet mit erheblichem Gegenwind von einzelnen Bevölkerungsgruppen rechnen müssen.”